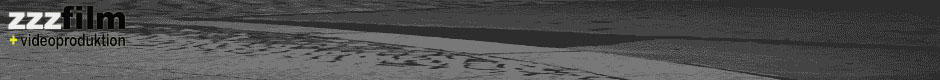> Märkische Oderzeitung, 30.06.04
TEXTE ZUR KUNST Mailingliste, 21.05.2004, Clemens Krümmel
Fast schon mögen Lebensläufe wie der in dem Film „Boatpeople“ aufgegriffene wie eine neue narrative Konstante globaler Migrationsbewegungen erscheinen, die in einem statistisch kalten Blick vielleicht sogar als „gewöhnlich“ empfunden werden können wie das zeitgenössische Modell eines Entwicklungsromans. Dessen Motor dürften immer wieder die Unmengen dramatischer Materie sein, die aus den ökonomischen und politischen Bewegungszwängen in der Welt unaufhörlich hervorgehen: Als Siebenjährige flieht Nguyen Thi Nga gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem an Lepra erkrankten Stiefvater vor dem Krieg aus Vietnam. Ende 1979 trifft sie als Teil der in der damaligen Presse „boat people“ genannten Gruppe von 1800 Vietnames/innen in Baden-Württemberg ein. Bei ihren Eltern und in ihrer christlich orientierten Internatsschule kämpft sie bald mit den unterschiedlichen Ansprüchen, die ihre Eltern, ihr Freundeskreis, ihre Lehrer/innen und Kolleg/innen, asiatische und europäische Kultur an sie stellen und lässt sich auf das schulförmige, labyrinthische Regelwerk und die Beurteilungswünsche ihrer neuen Umgebung ein. Mit sechzehn bricht Thi Nga mit den Traditionen ihrer Eltern das bedeutet für sie vor allem die riskante Infragestellung des Primats der Familie. Sie verlässt den Kreis der vietnamesischen Gemeinschaft in Freiburg und hat bald nur noch wenig Kontakt zu aus Vietnam kommenden Menschen. Nach über zwanzig Jahren fährt Tina Nguyen, wie sie in Deutschland genannt wird, weil es niemand gelingt, ihren Namen richtig auszusprechen, erstmals wieder nach Vietnam. Zu ihrer Schwester und ihrem leiblichen Vater hatte sie seit der Flucht in ihrer Kindheit keinen Kontakt. Auf dem Weg zu dieser Begegnung, die den Mittelpunkt des Films bildet, und zum Teil auch „direkt“ dabei, ist die Kamera anwesend, überraschender Weise ohne je aufdringlich zu wirken. Insofern könnte man sagen, dass der Film „Boatpeople“ in den eineinhalb Stunden seiner Laufzeit nicht nur die Biografie einer Frau nachzeichnet. Vor allem in seiner zweiten Hälfte wird das Filmteam zu mithandelnden Zeugen, und das Projekt stellt sich einer in dokumentarischen Porträts oft übergangenen Tatsache: Dass das filmische Interesse an einer bestimmten Person unter Umständen wichtige Veränderungsprozesse begleitet, manchmal sogar beeinflussen kann, mit allen Risiken, die der oder die Porträtierte mitzutragen bereit ist. Die zurzeit sehr geläufige Spielfilmformel der „Suche nach den Wurzeln“, die idealtypisch die Form einer Suche nach dem Vater (oder der Mutter) annimmt, findet hier jedenfalls keine ungemischte Erfüllung. Alles ist und bleibt gemischt und ungelöst: wenn etwa Tina Nguyen ihrem Vater und ihrer Schwester begegnet, zeigt sich statt einer filmgerechten Versöhnung eher eine langwierige Verhandlung, der Aufenthalt in Vietnam wird nicht als „Heimkehr“, sondern als die Fortsetzung einer Serie von mutigen, aber auch unausweichlich scheinenden Konfrontationen in einem Leben verständlich, das sich nicht auf einen inneren Widerstreit zweier Kulturen reduzieren lässt. Zugleich lässt Martin Zawadzkis Film keinen Zweifel daran, dass es ihm bei aller Aufmerksamkeit für die verschiedenen Kontexte nicht gelingen wird, diese größere Komplexität mehr als nur anzudeuten und welcher Reichtum an Erfahrungsmöglichkeiten aus der Akzeptanz dieser Tatsache entsteht. Er lässt allen Befragten Zeit, zwingt sie in keine Richtung und beurteilt sie nicht. Das ist nicht nur dokumentarische Gepflogenheit, sondern eine direkt beobachtbare Methode, die sich schon in Zawadzkis vorangegangenen Filmen finden lässt, in denen er einzelne Menschen durch lebensgefährliche Krankheiten und schwierige Lebensphasen begleitet (zum Beispiel „Isolator II“, „Der Vierte Sektor“ und „Herzklopfen“). Über die Besonderheiten ihrer jeweiligen biografischen Situation hinaus gelingt es ihm in diesem Film, Identitätszwänge als chronisches Krankheitsbild in einem Leben zu beschreiben und Einsamkeit und Wut in jedem „eigenen“ Leben und die Widersprüche, die sich aus ihnen ergeben, länger als gewöhnlich im Blick zu halten auch Dinge zu zeigen, die nicht in einem herkömmlichen Biografieschema Platz finden: zum Beispiel das Erstaunen über die besondere Qualität der Abwesenheit sichtbarer Gefühle, wo unbedingt Gefühle erwartet werden, ihre Stärke in eher unerwarteten Augenblicken. „Geschichtliche Fakten“ über die „boat people“ in Gestalt der Fernsehberichterstattung in West- und Ostdeutschland mit Aussagen der Protagonistin über ihr Selbstverständnis in dieser Geschichte zu konfrontieren, ist nur eine der grundlegenden Figuren in seinem Film. Ich fühle mich versucht zu sagen, dass Martin Zawadzki das Genre des dokumentarischen Porträts mit dieser beeindruckenden Arbeit vollkommen erschlossen hat. Aber das würde den mindestens ebenso beeindruckenden Anteil von Nguyen Thi Nga an diesem Film unterbewerten. Das wird eigentlich niemand passieren, der diesen Film mit offenen Augen angeschaut hat.